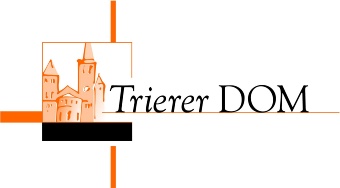Bischof Dr. Stephan Ackermann hat Domvikar Msgr. Ottmar Dillenburg, Leiter des Bereichs Personal im Bischöflichen Generalvikariat (BGV) Trier und Leitender Priesterreferent des Bistums Trier, und Domvikar Matthias Struth, Leiter des Bereichs Kinder, Jugend und Bildung im BGV Trier, zu Domkapitularen ernannt. Dillenburg und Struth nehmen damit die Plätze von Domkapitular Prälat Dr. Georg Holkenbrink, der zum Domdechanten ernannt wurde, und dem emeritierten Domkapitular Weihbischof Franz Josef Gebert ein.
Information
Öffnungszeiten Dom
April bis Oktober:
täglich von 6:30 Uhr bis 18 Uhr
November bis März
täglich von 6:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Keine Besichtigung während der Gottesdienstzeiten!
Am 30. April wird der Dom um 16 Uhr geschlossen!